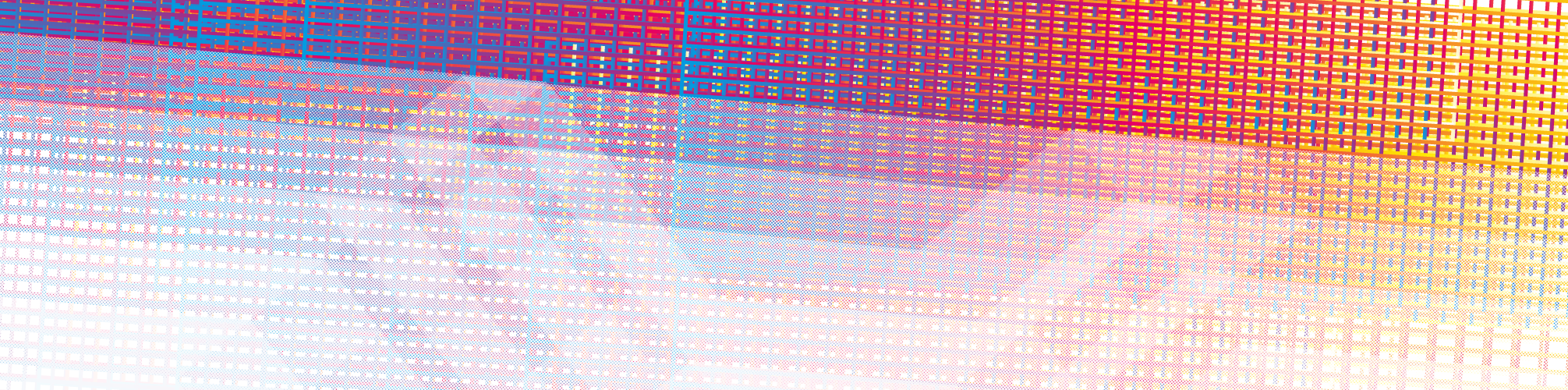Als Medien- und Theaterwissenschaftler habe ich gelernt, Driften zu vollziehen. Besser gesagt: abzuschweifen und Bilder für Komplexes zu finden. Es kann vorkommen, dass man – oder ich – dabei in einen freien Fall gerät. Und Verbindungen an einem vorbeirauschen, die dann zu ergreifen sind, sollte der Strang reißfest erscheinen. Ich möchte das Wagnis unternehmen, meinen Blick auf das Projekt Postdigitale Kunstpraktiken in der Kulturellen Bildung entlang dreier Pointen gleiten zu lassen.
Projektarbeit
Das Dilemma der Projektarbeit ist ihre auf vielen Ebenen angelegte Offenheit. Im tatsächlichen Sinn des Wortes Bedeutung, dem Lateinischen entlehnt, ist jedes Projekt ein Entwurf: prōicere (prōiectum) (Ausspr: prohizere): vorwärtswerfen, vorstrecken. Es ist – anders formuliert – auch ein Zukünftiges, dessen Vergangenheit – das Wie und Was des zu-Bearbeitens – zu Beginn des projektierten Rahmens nur skizzenhaft bekannt ist. Dies hat die nennenswerten Vorteile, dass ein Projekt immer Räume zur Verfügung stellt, in denen die Akteure zwischen den gesetzten Säulen, P-K-K-B, zu treiben angeleitet sind – ebenfalls gemäß der Wortbedeutung: lateinisch: prōiectāre: forttreiben, hinaustreiben. Von hier aus betrachtet ist dem Begriff bereits einprogrammiert dass die Ausführung, also Methodik und Gegenstände der Untersuchung, zwar festgelegt sein kann, ihre Konturen aber erst noch gezogen werden müssen im Prozess. Ein solch loses Gewebe birgt die Gefahr, dass wir Projektbeteiligten, die sich in den Maschen aufhalten, aufgefordert sind, unentwegt die ja vorhandenen Fäden festzuzurren, manchmal wieder locker zu lassen. Es beschreibt die aufgerufene Metapher Anforderungen, denen sich in Projekten arbeitende gegenübersehen: Flexibilität, Mobilität, Anpassungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie mindestens auch das Geschick zum sogenannten Kontakten. Im Spannungsfeld von Kontingenz und Sicherheit strebt das Subjekt danach – so kann ich es jedenfalls von mir sagen – Künftiges zu antizipieren, um das Gewebe, in das es sich eingebunden versteht, stabil zu halten. Ziehen wir das Ganze nun etwas fester und greifen nach dem …
… Postdigitalen
Das Digitale hat sich fest in unserer Alltagspraxis verankert. Ich erzähle Ihnen nichts neues, das wissen Sie bereits und das werden Sie heute noch häufiger hören. Doch genauer betrachtet fragt der Begriff des Postdigitalen ja: Was danach? Schnell schleicht sich der Verdacht ein, der Begriff sei eigentlich semantisch entleert, markiere er doch ein Danach, dessen Substanz sich im Geflecht digitaler Anwendungen verliert. Denn: Digital ist da. Die metaphorische Verweisung des Danach stattdessen gibt zu bedenken: Wir müssen das Digitale stets neu verhandeln. Seine zeitliche Eingebundenheit in Geschichte vermittelt schließlich angesichts digitaler Natives den Eindruck eines: Immerschon. Und darum meint das Postdigitale eben nicht nur, dass sich digitale Informationstechnologien in unsere Kultur irreversibel eingeschrieben haben. Nein, darin wäre die Produktivität des Begriffs, nämlich medienphilosophische Fragestellungen aufzurufen, stumm geschalten. Denn: Das Digitale modelliert unsere Sprache, Physis, Gesten immer auch und fortwährend. In diesem Sinne ist das Postdigitale nicht nur technologisch denotiert und aus dieser Perspektive medial. Es ist auch medial gemäß unserer leiblichen Artikulation: swiping, tapping, dragging, selfying … Darum sei das Post im Digitalen dringend zu betonen. Es zieht nach sich, was sich anzueignen ist:
Das Kuratieren …
… setzt hier an. Die kuratorische Praxis hat das Potential unseren Kunstbegriff – was er auch sei – im Lichte einer Komplizenschaft zu positionieren. Und ich sage Ihnen und Euch: Es ist kompliziert. Nicht nur bestehen wesentliche Aufgaben des Kuratierens in den folgenden: inhaltliche Zusammenstellung einer Schau, Austausch zwischen den Exponaten etablieren, Entwicklung von Sichtachsen, Kapitelgliederungen, Atmosphären, Bestimmung von möglichen Zuschauerpositionen – In-Gang-setzen eines offenen Dialogs. Auch sehen wir hierin vor allem angezeigt: Kuratorinnen produzieren Bedeutung. Nicht selten reagieren Künstler auf diese Deutungshoheit mit Zurückweisung. Mindestens einer formulierte hierzu: Kunst ist überflüssig. Und ermächtigte sich der Kunst erneut. Benjamin Vautier im Rahmen der documenta 5 1972, als die Kuratorinnen begannen sich konzeptuell in Ausstellungssituationen einzuschreiben. Doch treten wir einen Schritt zurück, wird deutlich: Die Einschreibung der Kuratorin in des Künstlers Werk zeigt uns an: Auch uns Betrachtenden ist das Werk zugetan – es ist offen dafür, Autorinnenschaft im Plural zu denken, einzugreifen und zu gestalten. Der kuratorische Eingriff beschreibt nicht nur eine autorengleiche Deutungshoheit gegenüber dem Kunstwerk – er markiert auch die Fähigkeit des Subjekts, sich angesichts des Kunstwerks zu positionieren, frei zu lesen, zu schöpfen, sich im freien Fall zu versenken.
Projektarbeit, Postdigitalität, Kuratieren: Was sie verbindet, ist die Bedingung als:
inhaltlicher wie ökonomischer Rahmen für Arbeit.
als technische Setzungen, die unser Handeln konfigurieren.
als Manövrieren von Bezügen, die Verlässlichkeit schaffen, wo das Werk uns offensteht.
Mein Anliegen an die Kulturelle Bildung ist – gerade im Verhältnis zum Digitalen –, das Subjekt – mich, dich, Sie, uns – in den Mittelpunkt zu stellen, es zu ermutigen, sich der Bedingungen zu ermächtigen. Und ich spreche bewusst nicht vom Profil, das immer schon durch die Setzung einer Perspektive konditioniert ist. Also spreche ich nicht nicht vom kuratierbaren Selbst, sondern vom Subjekt, das sich kraft seiner komplexen Verfasstheit durchdringen lässt und freien Willens aus sich schöpft und preisgibt, um die Dinge in die Hand zu nehmen. Also: Nehmen wir die Dinge in die Hand!