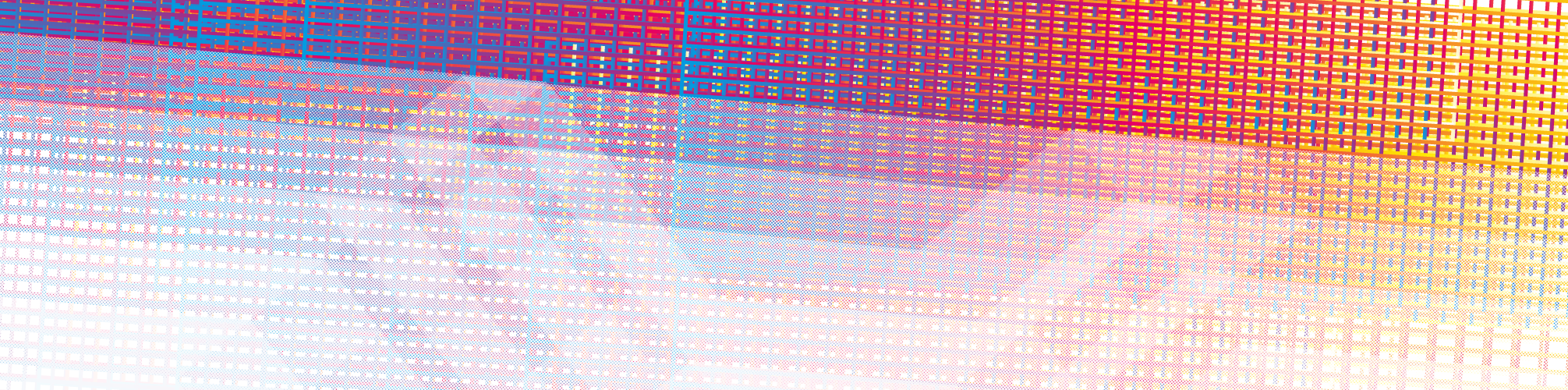Gestaltung empathischer Feedbackschleifen als Ordnungsmoment für hybride Ausstellungskontexte
Benjamin Egger, Judith Ackermann, Magdalena Kovarik
Häufig wird das postdigitale Zeitalter als die überdauernde Phase nach einem oder mehreren mit der Digitalisierung einhergehenden Umbrüchen verstanden. Doch der Einfluss digitaler Technologien auf die Her- und Ausstellungsprozesse von Kunstwerken wie sie unter dem Schlagwort der postdigitalen Kunst verhandelt werden, bedarf nicht nur einer einmaligen, sondern der fortwährenden Transformation – technologischer wie kuratorischer und rezeptiver Art. So werden tradierte Betrachtungs- und Bewertungsschemata aus dem Kunstsektor beständig zur Disposition gestellt und es gilt wiederholt neue Verfahren der Kuratierung und Erfahrbarkeit entsprechender Werke zu generieren. Auf den im Postdigitalen rekurrierten Umbruch folgt also immer eine Reihe vieler weiterer Umbrüche auf verschiedenen Ebenen. Für Cramer (2015: 19) steht der Begriff des Postdigitalen selbst bereits in enger Verbindung zu den Künsten, da er den chaotischen Zustand (messy state) erfasse, in welchem sich Medien, Künste und Design, seit ihrer Digitalisierung bzw. der Digitalisierung der Kanäle, über die sie vermittelt werden, befinden. Auch Jandric et al. (2018: 895) beschreiben das Postdigitale als messy und unpredictable. Es verbinde digitales mit analogem, technologisches mit nicht-technologischem und körperliches mit informatischem (ebd.). In ähnlicher Manier umschreiben Andersen/Cox/Papadopoulos (2014: 5) das Postdigitale als “messy and paradoxical condition of art and media after digital technology revolutions”. Die unterschiedlichen Beschreibungsversuche thematisieren allesamt eine zunehmende Auflösung vormals trennscharfer Kategorien einhergehend mit einer Krise bzw. dem Unvermögen neue Ordnung(en) herzustellen. So lässt sich das Entstehen des Begriffs postdigital (neben Begriffen wie post-internet oder new aesthetic) mit Berry/Dieter (2015: 4) als Ausdruck des menschlichen Versuchs werten, die verwirrenden Erfahrungen (disorientating experiences), die über das zunehmende Bewegen und den Aufenthalt in computerisierten Infrastrukturen vermittelt werden, einzuordnen und mit Sinn zu versehen. In diesem Zusammenhang lassen sich auch künstlerische Aktivitäten verorten, die unter der Bezeichnung postdigitale Kunstpraktiken „Computertechnik zum Ausgangspunkt nehmen, um durch sie bedingte und über sie hinausgehende Fragestellungen ästhetisch neu zu verhandeln“ (Ackermann/Doerk/Seitz 2019: 183). Dabei muss die konkrete Arbeit nicht notwendigerweise technisch realisiert sein, präsentiert sich jedoch als eine durch Digitalisierung informierte und über sie reflektierende Erscheinungsform, welche “eine rezeptive und kreative Auseinandersetzung mit ihrer soziotechnischen Spezifik“ (ebd.) ermöglicht. Auf diese Weise lassen sich entsprechende Werke für die Post-Internet-Künstlerin Marisa Olson etwa durch eine mediale Spezifität kennzeichnen, welche einen doppelten Bezug zum Internet herstellt, indem die Arbeiten einerseits einen (gesellschaftlichen) Zustand nach einer Interneterfahrung thematisieren und andererseits im Stil des Internets hergestellt werden (PKKB 2018: 122). Diese Beschreibung lässt sich auch auf den Begriff des Postdigitalen übertragen und auf den oben beschriebenen (noch) chaotischen Zustand nach der Digitalisierung beziehen. Hieraus erschließt sich unmittelbar die Frage danach, inwiefern sich Museen und Galerien der Auflösung des Chaos durch die gezielte Ausstellung, Kuratierung und Vermittlung postdigitaler Kunstwerke bereits widmen und welchen Beitrag sie leisten können.
Kuratieren zwischen den Sphären
Postdigitalität, verstanden als die Konditionen, die uns nach einer Phase des Umbruchs begegnen und welche uns mit den Bedingungen wie Auswirkungen digital-technologischer Infrastrukturen konfrontieren (Cramer 2015), evoziert die Erwartung, digitale Medien und Technologien wären längst unwiderruflicher Bestandteil – ästhetisch wie inhaltlich – jeglicher Ausstellungspraxis. Doch zeigt die Realität, das heißt die Anwendung und sprachliche Repräsentation hybrider Konditionen, dass physische und digitale Sphären oftmals nicht gleichwertig behandelt und gar nicht erst als einander bedingend gedacht werden.
Um den aus dem disparaten Verhältnis von Digitalität und Physizität folgenden Desideraten in der Praxis des Ausstellens zu begegnen, haben wir 14 qualitative Tiefeninterviews mit international tätigen und postdigital arbeitenden Künstler*innen sowie Kurator*innen geführt. Die Studie untersuchte die besonderen Eigenschaften postdigitaler Künste sowie die damit einhergehenden Herausforderungen und Potenziale für deren Ausstellung wie Inszenierung. In diesem Zusammenhang galt ein besonderes Augenmerk der Frage nach kuratorischen Hürden bei der Präsentation postdigitaler Künste zwischen physischen und digitalen Räumen, aber auch den biographischen Pfaden, die Künstler*innen nehmen, um in dem Feld aktiv zu werden sowie den Aneignungsstrategien, die sie dafür verfolgen. Die Ergebnisse aus der Interviewstudie werden für die Entwicklung neuer Formate der Kulturellen Bildung zur Anwendung gebracht, um Personen ohne künstlerischen Hintergrund oder mit geringen digital-technologischen Kenntnissen Kreativitätserfahrungen im Feld postdigitaler Kunstpraktiken zu ermöglichen und damit einhergehend eine neue Qualität in der Reflexion von Digitalisierung(sprozessen) zu erzeugen.
Kompetenzen im Digitalen zu erwerben, erfordert neben einem problemorientierten Umgang mit digitalen Technologien ein Bewusstsein darüber, wie physische Räume und digitale Infrastrukturen miteinander in Verbindung und Austausch stehen. Nicht selten aber werden diese Bereiche getrennt voneinander gedacht:
Abbildung 1: Die Grafik zeigt Zitate aus der durchgeführten Interviewstudie (PKKB 2018)
Obgleich in unserer Interviewstudie ausschließlich Expert*innen auf dem Gebiet digitaler Kunstproduktion und -präsentation befragt wurden, findet sich selbst dort eine dichotomische Verwendung der Begriffe digital und physisch, substituiert durch real, die auf eine defizitäre Ausstattung von Sprache(n) – insbesondere der deutschen – in Bezug zu den Möglichkeiten, die gemeinten Sphären zusammen zu denken hinweist. Insbesondere überrascht es, wenn anstelle von Physizität das Reale betont wird. Denn mit Blick auf die etymologische Bedeutung des Begriffs – entlehnt aus dem Lateinischen, realis für wesentlich – unterschlägt eine Abgrenzung von Digitalität zu Realität die normative Kraft digitaler Technologien, Interfaces und den durch sie fundierten Kommunikationsinfrastrukturen, welche Sprache, Physis, Gesten verändern und somit Mensch im Wesen. Wird berücksichtigt, dass die interviewten Personen teils als progressive Digital-Akteur*innen im Bereich digitaler Künste gelten, gibt sich zu erkennen, dass die weitreichende Trennung der Sphären eine sprachlich verankerte ist, denn die Befragten zeigten schon kraft ihrer Profession ein ausgeprägt problemorientiertes Verständnis digitaler Technologien. Dennoch: Gerade die sprachliche Fortschreibung eines Hierarchiegefälles der Räume etabliert diese als solche in der Praxis und vermag es, Bestrebungen von Innovation und Reflexion zu durchkreuzen.
Abbildung 2: Reflexxxions, Signe Pierce (US), Ausstellungs- und Performance-Ansicht, EIGEN+ART Lab, 24.04.–15.06.2019, Foto: PKKB 2019
Die US-amerikanische Performance-Künstlerin Signe Pierce führt zum besseren Verständnis ihrer künstlerischen Arbeit den Begriff Reality Artist ein – als diese stellte sie sich anlässlich der gezeigten Performance auf der Eröffnung ihrer Ausstellung Reflexxxions in der Berliner Galerie EIGEN+ART Lab vor. Aufschlussreich vor diesem Hintergrund ist, dass Pierce ihr Werk vorrangig über Soziale Medien verbreitet, das selbst erwählte Label daher nicht nur auf die Inszenierung des eigenen Lebens in Sozialen Medien verweist, sondern jene Kanäle infolgedessen als konstitutive Bestandteile ihres Begriffs von Realität justiert. Während ihrer Performance in Berlin trug die Künstlerin ein Smartphone eingefasst von einem Gestell vor ihrem Gesicht installiert und erweiterte Teile dessen für das Publikum sichtbar qua Screen in den Raum hinein. Subjekte verstehen sich hier als anthropotechnische (Sloterdijk 1999) Entitäten, das heißt qua „technischer Aktivität“ (Simondon 2012: 226) ständig durch Technik informiert. In Pierces Werk wird diese „notwendige Kopplung“ (Heßler 2016: 27) an Technik nicht nur als künstlerische Proklamation ansichtig. Technik im Lichte leiblichen Wohlseins und unter Berücksichtigung der daraus folgenden Symptomatiken materialisiert sich bei Pierce körperlich-performativ und kraft sprachlichen wie Sound-basierten Ausdrucks: „We’re the stars of our own reality shows. […] A virtual normality. A spectacle of banality.“ (Meier 2017), wird die Künstlerin zitiert. Mit ihren Kunst- und Realitätsbegriffen Reality Art und Virtual Normality installiert Pierce Ansätze in Sprache, die eine Überwindung sprachlich hervorgebrachter Binaritäten, aufzulösen in der Lage sein könnten.
Nicht nur gilt die Problematik, nach der die Sphären zumeist noch eine Trennung erfahren, für das sprachliche Vokabular, auch stellt sie das Feld des Kuratierens vor tiefgreifende Veränderungen. Eine Herausforderung, welche der Praxis eigentlich schon qua Geschichte eingeschrieben ist, denn kuratorische Handlungsformen waren/sind regelmäßigem Wandel unterlegen und erfuhren stets neue Bedeutung. Während einstmals Kurator*innen als Verwalter*innen musealer Sammlungen für das Ordnen, Bewahren und Vermitteln von Museumsartefakten beauftragt waren, entwickelte sich die Praxis seit den 1960er-Jahren im Zuge einer weltweiten Expansion des Kunstmarkts zu einer Themen-setzenden, oft freiberuflich und nomadisch ausgeführten Tätigkeit (Vgl. von Bismarck 2002: 56; 2012: 47ff.; 2014: 58ff.) – eine Entwicklung, welche wesentlichen Anteil an der heutigen Popularität des Berufs hat.
Die Kuratorin und Theoretikerin Irit Rogoff argumentiert, dass sich der Bereich des Kuratorischen auf zwei wesentliche Weisen ausgeweitet habe. Zunächst sei eine Expansion zu beobachten, die geprägt durch neo-liberale Vorstellungen von Arbeit Netzwerk- und Einflussbildung sowie Finanzierungsfragen in den Vordergrund stelle. Eine weitere Ausweitung meine die Migration kuratorischer Handlungsformen in andere Disziplinen, Wissensformen und Forschungspraxen (Vgl. Rogoff 2013: 41). Darin manifestiert sich die Tendenz, kuratorische Handlungsformen neben der Arbeit im Kunstfeld auch in anderen Bereichen zu verorten und zugleich abseits des Ausstellens weitere (Forschungs-)Formate in die Praxis einzubeziehen, wodurch sich das Kuratieren selbst als trans- und interdisziplinäre Disziplin einordnen lässt. Jedoch zeige die Expansion des Feldes vorrangig eine selbstreflexive durch Wiederholung des Bekannten gepräge Entwicklung, welche statt erneuernd eher inflationär zu bewerten sei. Rogoff plädiert daher dafür, die Disziplin in eine epistemologische Krise zu treiben, welche weniger die Attraktivität konkurrierender Interessen ins Feld führt, als sich mit den Leerstellen fehlenden Wissens produktiv in Beziehung zu setzen. Gerade die kuratorische Praxis sei ein Ort, an dem die Krise eingeübt werden könne (Vgl. Rogoff 2013: 43ff.). Es ließe sich dagegen halten, dass sich die Ausstellungs- und Museumsarbeit insbesondere aus Sicht des globalen Nordens unlängst im Krisenmodus befindet – jedenfalls ist eine kontrovers geführte Debatte um Restitutionsansprüche wie -verpflichtungen angestoßen, nicht zuletzt durch Bénédicte Savoy (2018). Die davon erhofften Impulse jedoch, tradierte Kunst- und Kurationsbegriffe sowie damit zusammenhängende Fragen nach Sammlung und Eigentum zu überdenken, scheinen sich bisher in den Praxen nicht nachhaltig eingeschrieben zu haben, um Rogoff beizupflichten.
Wenn sich im Falle des Kuratierens das Feld sowie die darin verortete Praxis angetrieben durch Diskurse um den Wert von Kunst, ihre Präsentation sowie Teilhabe und Zugänglichkeit mit stetigen Forderungen nach Neuausrichtungen konfrontiert sehen, muss dies in engem Zusammenhang mit den Konditionen des Postdigitalen gelesen werden. Ortsungebundene Zugriffsmöglichkeiten, globale Vernetzung, Vervielfältigungs- und Verbreitungspotenziale sowie niederschwellige Gestaltungsmöglichkeiten schüren den Zweifel an etablierten Kunst- und Ausstellungsbegriffen. Sie hinterlassen nicht nur chaotische Zustände im Genre zeitgenössischer Künste, das sich zusehends neusortiert – auf Produktions-, Rezeptions- und Ästhetik-Ebene –, sondern fordern die kuratorische Praxis, auf den genannten Ebenen zu reagieren.
Interviewstudie: Postdigitale Kunst aus der Perspektive von Künstler*innen und Kurator*innen
Ausstellungen sind für mich räumliche Verhandlungen.
Man steht auf einmal in der Schusslinie zwischen
zwei Arbeiten, die miteinander funken.
Direktor*in Medienkunstverein (PKKB 2018: 98)
Antworten auf und Positionen zu eben jenen Herausforderungen im sogenannten postdigitalen Ausstellen zu finden, war das vorrangige Ziel der durchgeführten Interviewstudie. Befragt wurden jeweils sieben international ansässige und tätige Künstler*innen und Kurator*innen, welche im Feld postdigitaler Künste zu verorten sind. Während die Künstler*innen schwerpunktmäßig zu ihren Biographien, Arbeitsweisen und Bildungsstationen interviewt wurden, galt das Interesse bei den Kurator*innen den Bedingungen der Präsentation und Vermittlung digitaler Künste in digitalen wie physischen Umgebungen. In einem iterativen Verfahren der inhaltlichen Verdichtung wurden unter Berücksichtigung der übergeordneten Fragestellungen fallinterne Kategorien gebildet. Diese wurden schließlich zu fallübergreifenden Kondensaten zusammengefasst und verbinden im Folgenden die Aussagen aus den Interviews zu einem leitmotivisch strukturierten Cluster, bestehend aus 14 Kategorien, die sich auf vier thematische Ebenen verteilen: Begriffsannäherung an Postdigitalität (1), Hybridität: Zwischen Materialität und Zugänglichkeit (2), Teilhabe: Vermittlungsstrategien und -bedingungen im Postdigitalen (3), Der Wert des Werks (4).
- Begriffsannäherung an Postdigitalität
Während sich das Postdigitale oder Postdigitalität besonders in den Medien-, Kunst- und Kulturwissenschaften als zentraler Begriff in den Diskursen etabliert hat, um strukturelle Veränderungen im Umgang mit digitalen Technologien sowie ihrer Wirkkraft auf Kultur zu beschreiben, zeigt die Befragung im kunstimmanenten Feld sowohl auf Künstler*innen- als auch auf Kurator*innenseite eine Zurückhaltung bis gar Ablehnung gegenüber dem Begriff. Motiviert scheint dies vor allem durch den irreführenden Präfix, welcher ein Danach anzeigt und so eine Überwindung digital informierter Zustände suggerieren könnte:
Wir leben im digitalen Zeitalter, nicht im postdigitalen Zeitalter. Es ist ja nicht so, dass wir beyond allem sind. Deswegen würde ich sagen, der Begriff ist noch nicht so perfekt. (Künstlerische Leitung Ausstellungshaus mit Schwerpunkt Digitalkultur, PKKB 2018: 161)
Ich kann mit dem Begriff nicht wirklich operieren. (Künstler*in, PKKB 2018: 239)
Vergleichbar mit anderen Versuchen Epochen zu beschreiben – siehe post-punk, post-feminism, postcolonialism –, birgt der Begriff das Potenzial, die widersprüchliche Spannung von Überwindung und Fortschreibung eines Zustandes in gleichem Maße zu erfassen (Cramer 2015: 14). Eine solche prozesshafte, lang anhaltende weniger eruptive Entwicklung kann zur Folge haben, dass gerade progressive Kunst-Akteur*innen mit einem Gespür für gesellschaftliche Zustände im Post-Zeitalter sich widerständig gegenüber der Beschreibung solcher Transformationen zeigen, da sie diese ja selbst schon thematisieren:
Wenn man sagt, das Postdigitale – oder der Begriff “postdigital“ – bedeutet ja eigentlich alles, heißt dies, man müsse nicht mehr speziell über das Digitale reden, weil heutzutage alles zumindest auf einer digitalen Grundlage basiert. […] Ich würde behaupten, unser Programm und die Ausstellungen die wir hier präsentieren, da geht es ganz zentral um das Postdigitale. […] Ich arbeite eigentlich ständig so [unter postdigitalen Bedingungen]. Also fördern diese für mich auch keine besonderen Herausforderungen. (Direktor*in Medienkunstverein, PKKB 2018: 97f.)
Chancen bietet der Begriff hingegen als retrospektives Analyse-Werkzeug, das die Erfahrungen zeitgenössischer (Kunst-)Akteur*innen mit digitalen Technologien im Vergleich zu jenen aufzeigt, für die der Umgang mit solchen Medien nicht von Beginn an in ihren Biographien selbstverständlich ist:
A: Für mich beschreibt [das Postdigitale] eher einen Zeitraum. Also dass eine Generation von Künstlern antritt, für die das Analoge sozusagen historisch ist.
B: Oder das Neue ist. (Kurator*in Medienkunstfestival & Medienkunstfestival-Leitung, Gemeinsames Interview, PKKB 2018: 209)
- Hybridität: Zwischen Materialität und Zugänglichkeit
Die Bedeutung digitaler Technologien im Verlauf der eigenen Biographie bedingt den ästhetischen, intellektuellen und angewandten Zugriff auf solche Medien, sowohl auf Produktions- wie auf Rezeptionsebene. Zum Zweck der Vermittlung sollten daher Publikumsbedarfe im Sinne ihrer Gewohnheiten berücksichtigt werden:
Wie sind die Seh- und Lesegewohnheiten? Mit denen muss man arbeiten. Man hat eine Minute, vielleicht. (Kurator*in Medienkunstfestival, PKKB 2018: 214)
Eine Berücksichtigung der Bedarfe kann sich entweder affirmativ gegenüber den Gewohnheiten der Betrachter*innen gestalten und somit ein positives Kunst-Erlebnis ermöglichen. Es kann aber auch im Bewusstsein über Gewohnheiten diese mittels Technologien kritisch durchkreuzen, um eine reflexive Erfahrung im Umgang mit Technologien zu erzeugen. Solche Erlebnisse bergen das Potenzial, Bildungsmomente zu schaffen, indem sie etwa den formenden Charakter digitaler Medien thematisieren. Gemeint ist, dass diese nie rein digital, sondern stets als digital und physisch konfigurierte Hybride denkbar sind.
Ich bin im Dialog mit einem Algorithmus. (Künstler*in, PKKB 2018: 165)
Erst durch die unauflösliche Bindung an ihre Hardware, den physischen Rahmen, und nicht zuletzt unsere Sinne, die sich auf sie einstellen, werden sie erfahrbar. Unsere sich durch digitale Technologien transformierenden Routinen zeigen so den normativen Status des Digitalen auf. Der verschränkte Status digitaler und physischer Sphären markiert das Wesen des Postdigitalen und wird entsprechend häufig in postdigitalen Kunstpraktiken ansichtig:
Künstler übersetzen digitale Ästhetik in das Physische – klassischer Post-Internet-Gedanke – aber auch wieder zurück, sodass eine Verschränkung entsteht und man nicht mehr trennen kann zwischen realer und virtueller Welt. Das entfällt. (Freie Kurator*in Digitale Künste, PKKB 2018: 34)
Dies legt zugleich auch nahe, virtuelle Räume nicht als reine Möglichkeitsumgebungen zu betrachten – anders, als es die französische Herkunft des Wortes virtuel ankündigt. Virtuelle Räume haben die Kraft erkenntnisreiche und bildungsspezifische Transformationen auszulösen – um auf die Bedeutung im Lateinischen zu referieren: virtus für ‚Kraft’. Analog dazu handelt es sich auch bei Ausstellungsdisplays um Möglichkeitsräume und Kraftfelder, deren Wirkweisen immer rückzubinden sind an ihre physische Rahmung, nicht zuletzt uns, das Publikum, welches das Werk sinnlich erfährt und ihm somit erst Sinn verleiht. Die Einbindung digitaler Medien in Ausstellungskontexte kann Sinneserfahrungen derart erweitern, dass sie Sinnes-fordernd andersartige Bild-, Raum-, Zeit-, Bewegungs- und Soundkonstellationen liefern. Sowohl auf Produktions- wie auf Kurations- und Vermittlungsebene müsse hier das Ziel sein, neue Bildordnungen zu ergründen, bspw. mittels digitaler Technologien andere Körper anzunehmen, in Werke abzusteigen, einzutauchen, sie zu ergründen oder durch die Verknüpfung mit Referenzwerken unseren Blick-Horizont über das Werk hinaus zu erweitern:
Toll ist, dass man über VR neue Perspektiven einnehmen kann, eine neue Sicht […] Andere Bildordnungen zu ergründen, Perspektiven einnehmen zu können, die uns sonst verwehrt blieben. (Freie Kurator*in Digitale Künste, PKKB 2018: 31)
Wie das wirkt, wenn man da hineingelassen in diese komische Landschaft, abtaucht, einen anderen Körper annimmt. (Freie Kurator*in Digitale Künste, PKKB 2018: 13)
Es ist eine tolle Option, mittels mittlerweile sehr guten Bildauflösungen Referenzwerke einzublenden. Da kann man über digitale Medien – Tablet, Smartphone – neue Blick-Horizonte in einer Ausstellung erschließen. (Freie Kurator*in Digitale Künste, PKKB 2018: 17)
- Teilhabe: Vermittlungsstrategien und -bedingungen im Postdigitalen
Die enge Verknüpfung der Produktions-, Kurations- und Vermittlungsebene im postdigitalen Kunstfeld offenbart, dass die Bereiche aufgrund des das Feld kennzeichnenden Merkmals der Teilhabe zunehmend verschwimmen. Wenn ein Publikum aktiv in das Werk eingebunden wird, sind vermittelnde Strategien von Beginn an notwendig, etwa in Form technischer Betreuung. Solche Maßnahmen sind in das kuratorische Entscheidungsfeld einzubeziehen. Gerade weil sich digitale Technologien unerlässlich in unsere Alltagspraktiken eingeschrieben haben und Teilhabeprozesse wesentliches Gestaltungsmerkmal postdigitaler Kulturen sind (Ackermann/Egger/Scharlach i. Dr.), ist von deren Integration in die verschiedenen Ausstellungsdisplays auszugehen. Doch zeigt sich auch, dass der Umgang mit Technologien zumeist intuitiv-autodidaktisch geschieht, selbst unter Künstler*innen, die sich mit wesentlich komplexeren Anwendungen beschäftigen:
I´ve been programming for many years. […] It was all self-taught. […] When I need something that I don’t know, I just try to learn by a book, search for it online. (Künstler*in, PKKB 2018: 202)
Daher gilt es, die Einbettung solcher Medien in ausstellerische Kontexte derart zu gestalten, dass sie reflexive Vorgänge anstoßen können. Oftmals jedoch wird den Besucher*innen nicht die gestalterische, intellektuelle und insbesondere verantwortungsvolle Kompetenz im Zusammenhang mit geöffneten Teilhabeformaten zugetraut, obwohl erkannt wurde, dass dies ein allgemeines Bedürfnis unter Besucher*innen beschreibt. So werden etwa Online-Ausstellungen, die eine kuratorische Beteiligung ermöglichen, als positiv bewertet, jedoch nicht als geeignet für die eigene Institution befunden:
Ich habe mir [Online-Ausstellungen] bei anderen Häusern angeschaut. Da gibt es ein paar Experimente, die ich ganz interessant finde. Nicht unbedingt übertragbar zu uns. […] Ich glaube, dass bei uns – also bei mir persönlich gar nicht – aber bei der Direktion oder den Kollegen ein bisschen Skepsis herrscht. […] Es ist ziemlich viel Aufwand, das zu entwickeln und zu betreuen, zu moderieren. Und dann die Angst, dass irgendwelche rassistischen, pornografischen – oder was auch immer – Inhalte eingespielt werden. (Museumskurator*in Zeitgenössische Kunst, PKKB 2018: 74f.)
Dabei bekundet eine Mehrheit der befragten Kurator*innen, dass sie die Vermittlungsebene im Ausstellen immer schon als der kuratorischen Leistung implementiert versteht – Kurator*innen verfügen daher über die Instrumente solche offen gestalteten Teilhabeprozesse moderierend einzuleiten und zu betreuen:
Für mich ist eine Ausstellung als Format oder als Medium Vermittlung. Mit dem Bau eines Narrativs mache ich diese Arbeiten auf eine andere Art und Weise zugänglich, als sie es vielleicht wären, wenn sie nur für sich allein stehen würden. (Direktor*in Medienkunstverein, PKKB 20018: 104)
Welche Informationen und Zusatzinformationen zu den Werken in welcher Form den Betrachtern wann mitgeben? Wie viel Aktion sollen sie dafür selber betreiben? Diese Informationsarchitektur ist tatsächlich Teil des kuratorischen Konzepts. (Museumskurator*in Zeitgenössische Künste, PKKB 2018: 79)
Der Wunsch, verstehen zu wollen, wird von den Befragten dabei als wesentliches Grundbedürfnis eines prototpyischen Publikums angenommen, welches es nicht nur für die Ausstellungsgestaltung anzuregen, sondern auch in über diese hinausgehenden Formaten zu adressieren gelte.
Ich höre immer wieder von Leuten, die unsere Ausstellungen besuchen: „Ja, ohne eine Führung hätte ich das gar nicht verstanden.“ Das finde ich ein bisschen übertrieben. […] Aber das ist wirklich immer noch das beliebteste Format. (Direktor*in Medienkunstverein, PKKB 2018: 105)
Viewers want very literal work. (Künstler*in, PKKB 2018: 121)
Doch stellt dies die Ausstellungsarbeit vor die Frage, auf welchem Wege Verstehensprozesse ermöglicht werden sollen. Priorisiert ein Publikum Wissen auf direktem Wege oder über den Umweg der Erfahrung?
Ich versuche, die Leute dorthin zu bringen, dass sie in der Lage sind, Fragen zu stellen. Das können Sie aber nicht, wenn sie von vornherein mit Informationen überschüttet werden. […] Was interessiert dich an der Ausstellung? Warum guckst du dir das an? Willst du Erfahrung oder willst du Wissen? (Museumskurator*in Zeitgenössische Künste, PKKB 2018: 80f.)
Wird Wissen durch Erfahrung gedacht, werden Werk- und Ausstellungsinformationen über das kuratorische Konzept mit-artikuliert, indem sie als Bestandteil einer Fragestellung in ein Narrativ eingebunden werden. Aus dieser Perspektive verstehen sich die auszustellenden Werke als Motive – bildlich wie interpretativ – und werden in eine bestimmte Perspektive gerückt. Dies adressiert ein kuratorisches Verständnis, welches Dialoge in Gang setzen möchte und von Künstler*innen wie Kurator*innen in gleichem Maße als ihr Prinzip beschrieben wird:
I also occasionally curate exhibitions. This always comes back to the discussion of participation. I really like to be able to initiate dialogue. (Künstler*in, PKKB 2018: 131)
Ich will nicht sagen „es [Ausstellungen] sind begehbare Texte“, aber es sind Diskurse, die in Dialog gebracht werden. Und man kann aber da reingehen. (Direktor*in Medienkunstverein, PKKB 2018: 98)
Um Ausstellungen als nicht-hierarchische, kollaborative Prozesse zu konzipieren, wurde 2017 der Begriff des Edu-Curating eingeführt (Villeneuve & Rowson Love 2017). Im Lichte des Postdigitalen erfordert ein solches Ausstellungsverständnis neben einer gleichberechtigten Zusammenführung von Produktions- und Rezeptionsebene auch digitale und physische Sphären zusammenzuführen. Aus dieser Perspektive bleibt es unausweichlich, das Publikum wesentlich in die Ausstellungsarbeit einzubinden. Denn: Es ist erst die Öffentlichkeit, welche jede Ausstellung konstituiert, sofern Ausstellen bedeutet, Artefakte einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen (von Bismarck 2012: 47).
- Der Wert des Werks
Vor dem Hintergrund des digitalen Wandels: Was ist eigentlich die Rolle eines Museums und der Ausstellung? Gewinnt oder verliert das Original an Bedeutung? (Museumskurator*in Zeitgenössische Künste, PKKB 2018: 69)
Das hohe Teilhabepotenzial am Entstehungs- und Fortbestehungsprozess eines Werks in den Postdigitalen Künsten wirft Fragen nach der Relevanz des Originals auf. Erst dank der Einbringung eines Publikums könne das Kunstwerk derart entmystifiziert werden, dass sich vordefinierte Bedeutungszusammenhänge für diverse – auch niederschwellige – Lesarten öffnen.
Herausforderung und Chance ist, das Kunstwerk als Kunstwerk zu hinterfragen. Wenn es nur noch Code ist, müssen sich Kurator und Künstler fragen, wie damit umgehen. Ob man es nicht langsam entmystifizieren muss. (Kurator*in Medienkunstverein, PKKB 2018: 210)
Anders gesagt, konstituieren die Besucher*innen als Ko-Akteur*innen auf einer – ideellen – Ebene mit Kurator*innen und Künstler*innen die Ausstellung und die damit zusammenhängende Werkbedeutung nicht nur gemäß eines wissenschaftlichen Draufblicks sondern auch handelnd-performativ mit. Kuratorische Entscheidungsfelder werden auf diese Weise geöffnet und verschränken Rezeptions- und Produktionsebenen miteinander. Dies erlaubt, die Abgründe der Kunst nun gemeinsam zu betreten.
Das meiste [Kunst] kann man [in der Schule etwa] gar nicht zeigen, weil es natürlich abgründig ist. Aber dafür ist ja die Vermittlung da. (Kurator*in Medienkunstfestival, PKKB 2018: 227)
Es erfordert aber auch, den Besucher*innen Diskurse über technik-philosophische Fragestellungen anzubieten, um Technik-reflexive Erfahrungen auszulösen. Die vielfach hier angedeutete hybride Stellung digitaler Technologien, welche deren Prägkräfte auf Kultur meint, gilt es daher als Dispositiv zu verstehen, demgegenüber wir uns nur in dem Bewusstsein kritisch distanzieren können, dass keine Betrachtungsweise auf den Gegenstand auskommt, ohne längst schon in dessen Bedeutungsraum wie Wirkweisen involviert zu sein.
Es ist bei Medienkunst allgemein immer die Herausforderung für die Kuratoren, Restauratoren, den Apparat als Dispositiv mitzudenken. […] Es ist ja nicht so, dass ich in einen x-beliebigen Farben-Laden gehe und meine Pigmente kaufe. Sondern ich kaufe immer schon ein Stück Unternehmensphilosophie […]. (Freie Kurator*in Digitale Künste, PKKB 2018: 12f.)
Kunst oder im Ausstellen kunstvoll eingesetzte Technologien, die Technologien thematisieren oder portraitieren, haben zugleich Anteil an diesen Technologien. (Bense 1998 [1949]: 124). Sie können so den Blick vom Mittelpunkt des Mediums abwenden hin zu dessen Rändern und seine öko- wie sozio-politischen Wirkweisen thematisieren:
Heutzutage sind Oberflächen total politisch. (Direktor*in Medienkunstverein, PKKB 2018: 100)
Es ist daher unerlässlich, dass nicht nur ein kleiner Kreis eingeweihter Software-Entwickler*innen oder eben Kunst-Expert*innen über die Hoheitsmacht verfügt, Programme – technischer wie kultureller Art – zu gestalten, sondern hierarchisch organisierte Gestaltungsstrukturen aufgelöst werden hin zu einer Publikumszentrierung, welche Fragen, Wünsche, Zweifel – also die Diversität einer Öffentlichkeit – einbringt in das Display. Auf diese Weise verschiebt sich die Frage nach der Identität des Adressat*innenkreis hin zu: Wer verfügt über Gestaltungsräume und wie zugänglich sind diese?
Es ist unglaublich wichtig, dass wir Künstler, dass Kuratoren, dass Leute aus verschiedenen Bereichen sich mit diesen Programmen beschäftigen. Verschiedener Geschlechter. Verschiedener kultureller Hintergründe. Dass am Ende nicht nur Ingenieure aus dem Silicon Valley entscheiden, was Kunst ist und was nicht. (Künstler*in, PKKB 2018: 187)
Wie weit muss sich die Kunst öffnen für ganz andere Kreise, die keinen Kontakt haben? Die Frage muss man an die Institutionen stellen, aber natürlich auch an die Künstler: Wer ist mein Adressat? (Medienkunstfestival-Leitung, PKKB 2018: 211)
Und so können sich die Grenzen der Physik zwar nicht ins Undenkbare, aber die Mauern von Museen und Ausstellungshäusern ins Mögliche, das heißt: ins Virtuelle, erweitern.
Was mich an VR-Ausstellungen fasziniert, ist, dass sich unendliche Möglichkeiten ergeben. Alles, was im normalen Ausstellungsraum nicht möglich war, ist jetzt möglich, das heißt, die Grenzen der Physik sind irgendwie aufgelöst. (Künstlerische Leitung Ausstellungshaus mit Schwerpunkt Digitalkultur, PKKB 2018: 142f.)
Zeitgenössische postdigitale Künste im Cluster
Um die Anforderungen postdigitaler Kunst an eine Integration in aktuelle physische wie digitale Ausstellungspraktiken auch vom Werk ausgehend erfassen zu können, wurde in einem weiteren Schritt eine umfassende Analyse von achtzig zeitgenössischen Arbeiten nationaler und internationaler Künstler*innen unterschiedlicher technologischer und inhaltlicher Ausrichtung durchgeführt. Bei der Auswahl der Künstler*innen wurde darauf geachtet, eine vielfältige und damit repräsentative Mischung aus dem postdigitalen Feld abzubilden. Um insbesondere aktuelle Anforderungen zu berücksichtigen, wurden ausschließlich Arbeiten aus den Jahren 2014 bis 2018 ausgewählt. Das Tableau umfasst sowohl etablierte Einzel-Künstler*innen und Newcomer*innen der Szene als auch Kunst-Kollektive aus dem In- und Ausland. Auf diese Weise wird die Diversität der produzierten postdigitalen Kunstformate auch in der gewählten Stichprobe abgebildet.
Die Werke wurden in Bezug auf die Kategorien Sparte, Technologie, Rezeption und Output untersucht. Den übergeordneten Kategorien wurden jeweils Hashtags zugewiesen, um unterschiedliche Unterkategorien auszudifferenzieren, welche induktiv am Material entlang entwickelt wurden. Für die Kategorie Sparte finden sich verstärkt die Unterkategorien #DigitaleKulturGesellschaftskritik, #ÜberwachungDatenschutz, oder #Internetkunst. Technologie beschreibt die benutzten Tools, Programme und Technologie-Umgebungen (Software/Hardware) sowie technische und algorithmische Methoden, welche für die Kunstproduktion eingesetzt werden: Als Unterkategorien konnten etwa #MaschinellesLernen, #PhysicalComputing, #VirtuelleRealität, #Video, #Sensoren oder #Code ausgemacht werden. Die Rezeption bezieht sich auf die User*innen-Einbindung im Sinne der Frage danach, wie etwas erlebt wird, und wurde in die Bereiche #passiv, #digitalinteraktiv, #partizipativ, #kollektiv, #begehbar und #körperlicherfahrbar gegliedert, die entsprechend ihres räumlichen Fokus einen weiteren Zuschnitt in die Felder digital und physisch erfahren. Die Kategorie Output wird als Modalität verstanden und beschreibt die finale Form, in dem sich eine Arbeit befindet bzw. präsentiert oder auch genutzt wird. Hier ergaben sich die Unterkategorien #Visuals, #Video, #Sprache, #Sound, #Installation, #VirtualExperience, #Skulptur, #Web-Tool, #App und #Plugin.
Die Auseinandersetzung mit den Arbeiten zeigte, dass es nicht möglich ist, eine Künstler*in, bzw. ein Projekt in einer einzigen Subkategorie zu verorten. Stattdessen bedienen sich die postdigitalen Arbeiten und ihre Produzent*innen nahezu immer verschiedener Technologien und Hilfsmittel gleichzeitig und erzeugen damit auch unterschiedliche Modi und Rezeptionsformate parallel, worin sich die dem Postdigitalen generell zugeschriebene Hybridität spiegelt. Exemplarisch sei hier das Projekt LAUREN von Lauren McCarthy aus dem Jahr 2017 angeführt, für das die Künstlerin in die Rolle einer menschlichen persönlichen Assistentin schlüpft, welche an die KI-Anwendungen Siri oder Alexa angelehnt ist und live über Netzwerk-Kameras das Leben von Menschen in ihren Wohnungen optimiert. Das Projekt wurde in der Kategorie Rezeption mit den Hashtags #digitalinteraktiv und #körperlicherfahrbar gelabelt. Mit denselben Hashtags ist auch Kyle McDonald’s Exhausting a Crowd aus dem Jahr 2017 getagged. Auch er benutzt Kameras, in diesem Fall aber Netzwerk-Überwachungskameras, welche den Piccadilly Circus in London filmen: Die User*in kann sich den Feed anschauen und live im Video mit Sprechblasen das Geschehen kommentieren oder vor Ort in das gefilmte Geschehen eingreifen. Trotz der Überlappung der Subkategorien und obwohl die Künstler*innen beide Überwachungskameras als Technologie einsetzen, sind die Projekte sehr unterschiedlich, da sie jeweils in Verbindung mit weiteren Spezifizierungen auftreten. Dies zeigt deutlich, dass sich postdigitale Künste nicht auf ihre Herstellungs- und Präsentationsweisen reduzieren lassen, sondern sich selbst mit vergleichbaren technologischen Sets und/oder Rezeptionsformen eine große Diversität im künstlerischen Ausdruck erzeugen lässt. Dennoch fallen in der Analyse der achtzig untersuchten Arbeiten besondere Häufungen von Hashtags bzw. Subkategorien auf: So stellt sich z.B. heraus, dass die Kombination der Hashtags #digitalinteraktiv und #physicalexperience wie im oben genannten Beispiel, die auf hybride Interaktions- und Erfahrungsräume im Zusammenhang mit postdigitaler Kunst verweisen, besonders häufig vorkommt. Anhand weiterer im Sample auffindbarer Subkategorien-Cluster lassen sich drei dominante Erfahrungsarten identifizieren, die als interaktiv, immersiv und generativ zu beschreiben sind. Die Erfahrungsart interaktiv zeichnet sich dabei durch Häufungen der Subkategorien #code, #digitalinteraktiv, #physicalexperience und #physicalcomputing aus. Die Erfahrungsart immersiv kommt besonders in Hashtag-Häufungen aus #VR, #passiv-rezipierend und #installation, aber auch gemeinsam mit #digitalinteraktiv und #physicalexperience vor. Die Erfahrungsart generativ zeigt sich in Arbeiten mit den Hashtag-Häufungen #code, #installation, #passiv, #machinelearning und #text.
Zur Verdeutlichung der besonderen Qualitäten und Unterschiede in den jeweiligen Erfahrungsarten seien an dieser Stelle kurz die Besonderheiten der einzelnen Metakategorien anhand von Beispielen aus der Kunst vorgestellt: Die Spezifität der interaktiven Erfahrungsart zeigt sich etwa in Arbeiten wie dem Penguin Mirror von Denny Rozen aus dem Jahr 2015. In dieser wird eine Vielzahl identer Objekte wie Pixel angeordnet, die mit Hilfe von Sensoren die Bewegungen der Menschen, die sich davor aufhalten, wie ein Spiegel reflektieren. So entsteht eine Interaktion zwischen den menschlichen Handlungen und der mechanischen Umsetzung (Sensor-Code-Motor-Kommunikation) in Form der Pixel.
Auch Mnemograph von Rebecca Lieberman aus dem Jahr 2016 ist ein gutes Beispiel für die interaktive Erfahrungsart. Die Installation besteht aus einem Schreibtisch, an dem man eine Erinnerung in Bezug zu einem Thema, etwa “describe a memory about hands”, auf ein vorbereitetes Blatt Papier schreibt und dieses in einen Spalt im Tisch schiebt. Der Text wird mit Hilfe von Machine Learning nach Schlagworten gescannt und basierend darauf wird die Erinnerung einer anderen Besucher*in, welche ähnlich zu der eigenen ist – also gemeinsame Schlagwörter aufweist – durch den Spalt wieder ausgegeben. So entsteht ein Kreislauf von Texten und Erinnerungen zwischen den User*innen. In Matt Romein’s Projekt Real Time Avateering aus dem Jahr 2016 erstellt der Künstler einen 3D-Scan seines Körpers und digitalisiert die eigenen Bewegungen durch Motion-Capture-Technologien, um seinen Avataren beizubringen, wie sie sich zu bewegen haben. Diese hyperrealistischen Avatare seiner selbst setzt er in die Virtuelle Realität, wo sie in Echtzeit von User*innen mit Hilfe eines Motion Capture Suits animiert werden können. Das Beispiel weist durch die Kombination von VR-Technologie und User*innen-Einbindung deutliche Schnittmengen zur Erfahrungsart immersiv auf.
Im Feld der immersiven Erfahrungsart finden sich verstärkt Virtual Reality-Arbeiten. So kreiert die Künstlerin Ziv Schneider in ihrem Werk The Museum of Stolen Art aus dem Jahr 2014 eine VR-Erfahrung, in der man sich in einem virtuellen Museum befindet, in dem Kunstwerke ausgestellt sind, die enteignet oder gestohlen wurden. Die Besucher*in kann sich via Mobilgerät und VR-Brille in individuellem Tempo durch das Museum navigieren und die Werke erkunden. The Hereafter Institute des Amerikanischen Künstlers Gabe Barcia-Colombo aus dem Jahr 2018 ist eine großangelegte immersive Installation: ein Institut, das sich um unser digitales Leben nach dem Tod kümmert. Nach dem Betreten werden die Besucher*innen zu ihren Social Media-Gewohnheiten befragt und im Anschluss 3D-gescannt. In einem nächsten Schritt können sie über VR-Headsets verstorbene Menschen besuchen und Geschichten über diese hören. Zu guter Letzt wird die Besucher*in in einen Kinosaal geführt, wo das Begräbnis ihrer eigenen Social Media-Identität stattfindet: Auf der Leinwand werden Statusmeldungen und andere Aktivitäten bis zum kompletten Systemabsturz gezeigt, nun erscheint der zu Anfang erstellte 3D-Scan und man kann zusehen, wie das digitalisierte Selbst einem den Rücken zukehrt und in die Unendlichkeit geht. Beide genannten Projekte haben mehr oder weniger deutliche interaktive Anteile, jedoch liegt der Schwerpunkt in der immersiven Erfahrung.
In der generativen Erfahrungsart finden sich sprachbasierte Arbeiten aus dem Bereich Code Poetry. Mit Hilfe von Natural Language Processing (NLP) werden in diesem Kunstfeld durch Code Gedichte, Geschichten oder auch ganze Bücher generiert. In der Reihe Narrated Reality von Ross Goodwin aus dem Jahr 2016 erzählen etwa eine Kamera, ein Kompass oder eine Stechuhr Geschichten basierend auf Fotos, GPS-Daten oder der Uhrzeit. Mit Hilfe neuronaler Netzwerke, welche auf verschiedene literarische Quelltexte und deren unterschiedliche Schreibstile trainiert sind, werden die generierten Narrative jeweils auf Papierrollen ausgedruckt. Auch die Künstlerin Anna Ridler setzt in ihrer Arbeit Tulips aus dem Jahr 2018 Verfahren der KI ein, indem sie Maschinen mit Fotos von Tulpen darauf trainiert, neue bisher nicht existierende Tulpen zu generieren. Dies zeigt, inwiefern die Methode Maschinellen Lernens und das Feld der Künstlichen Intelligenz im Zusammenhang mit generativer Kunst eine wichtige Rolle einnehmen und für ganz unterschiedliche künstlerische Fragestellungen eingesetzt werden können. Auch im Feld der generativen Erfahrungsart finden sich Überlappungen zu den zuvor genannten Erfahrungsarten: Ein Beispiel für ein solches Projekt ist die Arbeit Flickering Existence von Liu Chang aus dem Jahr 2016, bei der die Besucher*in vor einem großen Monitor steht und von einer Kamera gefilmt wird. Dabei wird aus den Aufnahmen live ein abstraktes Portrait – bestehend aus netzartigen Strukturen und Punkten – generiert, wodurch das Projekt gleichermaßen interaktive wie generative Anteile aufweist.
Die Ausführungen zeigen deutlich, dass die identifizierten Erfahrungsarten keineswegs als trennscharf zu bewerten sind, sondern auch und sogar häufig gemeinschaftlich auftreten. Dies spiegelt sich auch in der Zuordnung der analysierten Werke zu den drei Metakategorien: So wurden sechzig Projekte der Kategorie generativ zugeordnet, sechsundfünfzig dem Feld interaktiv und fünfzehn dem Bereich immersiv. Während Interaktivität und Generativität somit nahezu Grundbedingungen des Postdigitalen Kunstschaffens zu sein scheinen, handelt es sich bei immersiven Arbeiten eher um einen darüber hinausgehenden (ästhetischen) Schwerpunkt.
Postdigitales Ausstellen – ein Ausblick
Aus den Erkenntnissen über die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse für das Kuratieren und Produzieren von Kunst an der Schnittstelle von digitalen und physischen Räumen und Technologien lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen für ein Postdigitales Ausstellen ableiten.
Um der Hybridität im Bereich Materialität und Zugänglichkeit zu begegnen, lassen sich Ausstellungsformate andenken, die unterschiedliche Start- und Eintrittsmöglichkeiten für die Besuchenden anbieten – digital wie physisch – und sich in Präsentation und Vermittlung über digitale und physische Räume hinweg ausdehnen. Dies empfiehlt die Gestaltung von Online-Ausstellungen mit einer physischen Anbindung sowie physische Ausstellungen mit digitalen Ausspielungen. Im Falle der Online-Ausstellung inkludiert ein solcher Ansatz beispielsweise die Arbeit mit Routern als Einstiegsszenario, was es ermöglicht, die Zugänglichkeit digitaler Inhalte durch den Aufbau eines rein lokalen, nicht mit dem Internet verbundenen Netzwerks an die Präsenz an einem physischen Ort zu koppeln (s. Abbildung 3) sowie Szenarien, in denen sich die Ausstellung als Reaktion auf die
Abbildung 3: Offline Art: „Are you still there?“, Aram Bartholl (D), Ausstellungsansicht Hamster Hipster Handy. Im Bann des Mobiltelefons, Museum Angewandte Kunst, Frankfurt, 25.04.–5.07.2015, Foto: Aram Bartholl 2015
physische Position der Besuchenden unterschiedlich darstellt. Im Falle der physischen Ausstellung ist insbesondere die Arbeit mit partizipativen Formaten denkbar, welche es Besuchenden gestattet, Werke vor Ort zu manipulieren, die als digitale Entsprechung konserviert und mit anderen geteilt werden können, um weiterhin als Visualisierung in die physische Ausstellung zurückgespielt zu werden, aber auch digital eingesehen werden zu können. Auch ist es denkbar, die physische Ausstellung durch die Integration digitaler Kanäle räumlich und zeitlich zu entgrenzen, in einem Sinne, dass sie über digitale Wege in das Alltagshandeln der (potenziellen) Besuchenden an andere Orten eindringt und sie kognitiv wie ästhetisch in den Kosmos der physischen Ausstellung (zurück)holt. So hat die von Kristin Klein und Nada Schroer kuratierte Ausstellung “Never AFK” im NRW-Forum Düsseldorf (Mai 2019) sich einerseits thematisch mit dem Phänomen des Livestreaming auseinandergesetzt und andererseits die entsprechenden Kanäle genutzt, um aus dem Museumsort heraus zu streamen und die Ausstellung an Orte zu bringen, an denen sie sonst nicht zugänglich gewesen wäre (s. Abbildung 4). Hier findet sich die in den Interviews angeklungene Notwendigkeit gut umgesetzt, die Besonderheiten des Postdigitalen aus mehreren Perspektiven in der Ausstellungspraxis zu beleuchten, was Kuratierung und Vermittlung gleichermaßen einschließt.
Abbildung 4: The Death of an Avatar, Dorota Gawęda (PL) und Eglė Kulbokaitė (LTU), Ausstellungsansicht Never AFK, NRW-Forum Düsseldorf, 10.05.–12.05.2019, Foto: Katja Illner, © NRW-Forum Düsseldorf 2019
In der Verschränkung der unterschiedlichen Ebenen gilt es, die Besucher*innen als relevantes Ausstellungsmoment zu konstituieren. Ihr Handeln im Sinne der erwähnten Teilhabe durch Interaktivität und Partizipation wird als verbindendes Element zwischen den einzelnen Sphären konzipiert – auf diese Weise wird eine zusätzliche persönliche Bedeutung geschaffen, die im Handlungsvollzug entsteht. Hierzu gilt es das Format der Online-Ausstellung weg von einem konkreten Ausstellungsszenario und hin zu einem digitalen Ausstellungshaus mit entsprechender Infrastruktur zu denken, in dem Besucher*innen und Künstler*innen Erfahrungen kreieren und teilen können und welches sie zu nachhaltigen Eingriffen befähigt. Diese lassen sich einerseits über eine Fluidität der angelegten Ausstellungen gewährleisten, andererseits können sie durch die Unterschiedlichkeit der Erfahrbarkeit einer Ausstellung je nach Eintrittspunkt und zuletzt durch die Vermittlung der über digitale und physische Ebenen verteilten Kopräsenz mehrerer Anwesender erzeugt werden. Wenn Verstehen und Bedeutungsproduktion sich klassischerweise nicht nur in der Beziehung von Einzelperson zu Werk, sondern auch im aktiven Austausch mit Gesprächspartner*innen vollziehen oder durch die Beobachtung anderer in ihrer Beziehung zum Werk, gilt es Gemeinschaftserfahrungen über digitale und physische Grenzen hinweg zu kreieren.
Für uns lässt sich dies durch die aktive Gestaltung und Forcierung von multisensorischen Rückkopplungsprozessen realisieren, welche wir als empathische Feedbackschleifen bezeichnen möchten. Der Begriff nimmt das von Erika Fischer-Lichte (2004) für das Theater eingeführte Konzept der autopoietischen Feedbackschleife zum Ausgangspunkt, welches eine Aufführung als sich selbst hervorbringendes Ereignis beschreibt, das sich in Echtzeit in Abhängigkeit von den kopräsenten Akteuer*innen (Schauspielende wie Publikum) vollzieht. Dieses Konzept übertragen wir auf den Ausstellungsbesuch im Zusammenhang mit postdigitalen Künsten, welche entsprechend der identifizierten Rezeptions- und Produktionsmodi generativ, immersiv und vor allem interaktiv ein über die reine Betrachtung hinausgehendes Handeln der Besucher*innen erfordern. Für Klotz (1997) eignet sich die “interaktive Kunstkategorie die darstellenden Künste an[…]”, wodurch sie auch in Bezug auf ihr Erleben in die Nähe von Aufführungen gerückt wird. In einer physischen Ausstellung ergeben sich aus diesem Zusammenhang unmittelbar performative Aspekte, welche Ackermann (2014) im Begriff des Hybrid Reality Theatres erfasst. Neben der Präsentation der (interaktiven) Artefakte selbst, werden im physischen Museumsraum immer auch die Handlungen mit selbigen ausgestellt (Abbildung 5). Auch wenn in solchen Szenarien in der Regel “nicht alle Exponate für die aktive Nutzung durch die Besucher[*innen] vorgesehen [sind], […] verbindet sich die Verwendung einzelner Artefakte mit den Einzel-Exponaten zu einem transitorischen Kunstwerk, das erst über die gleichzeitige Anwesenheit […] in seiner spezifischen Eigenart konstituiert wird” (Ackermann 2014: 76).
Abbildung 5: Unreal: eine Virtual-Reality-Ausstellung, Ausstellungsansicht, NRW-Forum Düsseldorf, 25.05.–30.07.2017, Foto: Judith Ackermann 2017
Um dieses Verfahren über das Szenario einer physischen Ausstellung mit digitalen Anteilen und/oder Themen hinaus in den Online-Bereich übertragen zu können, gilt es die dort vorhandene delokalisierte Kopräsenz (Kirschner 2013), die sich in dem ausschließlichen Wissen über eine imagined audience (Litt 2012) bzw. eine imagined community realisiert, in ein Moment der Wahrnehmung gleichzeitiger Anwesenheit zu transformieren. In ihrer basalsten Form lässt sich die digital vermittelte bloße Betrachtung von Ausstellungselementen über einen Bildschirm zunächst mit Abwesenheit gleichsetzen (Otto 2015: 99 ff). Hieraus ergibt sich, dass in einem ersten Schritt ein Gefühl von Anwesenheit erzeugt werden muss, damit sich die unterschiedlichen Akteur*innen gegenseitig in ihrem Ausstellungshandeln und ihrer Bedeutungsproduktion – nicht zwingend bewusst – beeinflussen können. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass das so erzeugte Gefühl für die digitale Kopräsenz in ein “affektives Mit-Sein” (Slaby i. Dr.: 6) transformiert wird, wie es der Begriff der Empathie beschreibt, der zur Präzisierung der von uns angestrebten Form von Feedbackschleife Verwendung findet. Empathie ist auf das Verständnis des Zustands einer anderen Person ausgerichtet. Sie ist gefühlstechnisch als neutral zu bewerten, da es ihr nicht um Sympathie oder Antipathie zu der anderen Person geht und auch nicht um die Identifikation mit jemand anderem. Stattdessen zielt sie darauf, aus einer verbleibenden Distanz heraus, eine andere Person zu verstehen und dabei emotionale und kognitive Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen (Breyer 2013: 13). Eine Trennung zwischen Selbst und Anderem bleibt erhalten. Die empathische Feedbackschleife zielt in diesem Sinne darauf, das emotionale Echtzeit-Erleben eines (Online-)Ausstellungsbesuchs wahrnehmbar zu machen, um es den einzelnen Beteiligten zu ermöglichen in einem empathischen Austausch miteinander zu treten. Anders als beim Live-Theater ist die damit verbundene Rückkopplung im Sinne einer Feedbackschleife noch nicht zwingend autopoietisch, da sie zunächst multisensorisch erfahrbar gemacht werden muss und entsprechende Feedbackmöglichkeiten implementiert werden müssen. Die Notwendigkeit der Formulierung eines entsprechenden Gestaltungskriteriums im Bereich Kopräsenz führt zurück auf die paradoxe Erfahrung, sich allein im Netz zu bewegen, während die gleichzeitige Anwesenheit menschlicher wie nicht-menschlicher Akteur*innen oftmals erst rückwirkend wahrgenommen wird – durch die Mittelbarkeit von Feedbackschleifen in Form messbarer Affekte, Zensurmechanismen oder die reflektive Rückbesinnung auf die Relevanz des eigenen (Daten-)Profils. Für eine Online-Ausstellung, die der Idee des postdigitalen Ausstellens folgt, ist daher entscheidend, dass die Ausstellungserfahrung als eine immer schon gemeinsame vermittelt und transparent gemacht wird – ohne Grenzen zwischen digitalen und physischen Ebenen zu ziehen. So sollen Handlungen des Publikums als dynamischer Strang im Sinne Reicherts (2013) erzählerischer Transformationsprozesse interaktiv hervorgebracht werden. Der Ausstellungsbesuch wird zum Ereignis, welches mit Martin Seel (2003) in seinem Auftreten unerwartet und mit dem Potenzial zur Veränderung des Sinns einer Situation versehen ist, wodurch sich die Ausstellung mit der Ereignishaftigkeit des Theaters trifft, wie sie auch Fischer-Lichte beschreibt. Die in diesem Kontext entstehenden Strukturen, die es menschlichen Entitäten gestatten, sich im Zusammenspiel mit digitalen Technologien gegenseitig zu erfahren und im Handeln und der Bedeutungsproduktion wechselseitig zu beeinflussen, kreieren eine flexible Ordnung für den postdigitalen Ausstellungsbesuch, welche es durch ihre Offenheit ermöglicht Emergenzen und chaotische Zustände zuzulassen und produktiv zu wenden.
Literaturverzeichnis:
Ackermann, Judith: „Digital Games and Hybrid Reality Theatre“, in: Beil, Benjamin/Freyermuth Gundolf S./Gotto, Lisa (Hrsg.), New Game Plus: Perspektiven der Game Studies, Bielefeld 2014, S. 63–88.
Ackermann, Judith/Egger, Benjamin/Scharlach, Rebecca: „Programming the postdigital: Curation of appropriation processes in (collaborative) creative coding spaces“, in: Postdigital Science and Education (i. Dr.)
Ackermann, Judith/Doerk, Marian/Seitz, Hanne: „Postdigitale Kunstpraktiken. Ästhetische Begegnungen zwischen Aneignung, Produktion und Vermittlung“, in: Jörissen, Benjamin/Kröner, Stephan/Unterberg, Lisa (Hrsg.): Forschung zur Digitalisierung in der Kulturellen Bildung, München 2019, S. 183–194.
Andersen, Christian Ulrik/Cox, Geoff/Papadopoulos, Georgios: „Postdigital research – Editorial“, in: APRJA 3(1), 2014.
Bense, Max: „Technische Existenz“, in: Walther, Elisabeth (Hrsg.): Ausgewählte Schriften in vier Bänden. Band 3. Ästhetik und Texttheorie, Stuttgart 1998 [1949], S. 122–146.
Bismarck, Beatrice von: „Curating”, in: Butin, Hubertus (Hrsg.): DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Köln 2002, S. 56–58.
Bismarck, Beatrice von: „Curating Curators”, in: Texte zur Kunst, 86 (The Curators), 2012, S. 43–61.
Bismarck, Beatrice von: „Curating”, in: Butin, Hubertus (Hrsg.), Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Köln 2014, S. 58–61.
Breyer, Thiemo: „Empathie und ihre Grenzen: Diskursive Vielfalt – phänomenale Einheit?”, in: Ders. (Hrsg.): Grenzen der Empathie. Paderborn 2013, S. 13–42.
Cramer, Florian: „What Is ‘Post-digital’?”, in: Berry, David M./Dieter, Michael (Hrsg.), Postdigital Aesthetics. Art, Computation and Design, London: 2015, S. 12–26.
Berry, David M./Dieter, Michael: „Thinking Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design”, in: Dies. (Hrsg.): Postdigital Aesthetics. Art, Computation and Design, London 2015, 1–11.
Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen, Frankfurt a. M. 2004.
Heßler, Martina: „Gilbert Simondon und die Existenzweise technischer Objekte – eine technikhistorische Lesart“, in: TG Technikgeschichte, Jg. 83, 2016, S. 3–32.
Jandrić, Petar/Knox, Jeremy/Besley, Tina/Ryberg, Thomas/Suoranta, Juha/Hayes, Sarah: „Postdigital science and education“, in: Educational Philosophy and Theory, Bd. 50, Nr. 10, 2018, S. 893–899 (Auch unter: DOI: 10.1080/00131857.2018.1454000).
Kirschner, Heiko: „Go Live!: Der User-Livestream als Präsentationsbühne“, in: Lucht, Petra/Schmidt, Lisa-Marian/Tuma, René (Hrsg.): Visuelles Wissen und Bilder des Sozialen, Wiesbaden 2013, S. 157–175.
Klotz, Heinrich: Kunst der Gegenwart. Museum für Neue Kunst, München 1997.
Litt, Eden: Knock, Knock. Who’s There? The Imagined Audience, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 56:3, 2012 , S. 330-345 (Auch unter: DOI: 10.1080/08838151.2012.705195).
Meier, Anika: „‘Reality Artist’ Signe Pierce. ‘Ich bin Pop und ich bin Kunst’“, in: https://www.monopol-magazin.de/reality-artist-signe-pierce, 2017.
Otto, Ulf: Internetauftritte. Eine Theatergeschichte der neuen Medien, Bielefeld 2012.
PKKB: Postdigitale Kunst aus der Perspektive von Künstler*innen und
Kurator*innen – eine qualitative Interviewstudie im Rahmen des BMBF-Projekts Postdigitale Kunstpraktiken in der Kulturellen Bildung (PKKB). Transkribiertes Interviewkorpus, 2018, (unveröffentlicht).
Reichert, Ramon. „Die Macht der Vielen. Eine performative Perspektivierung der kollaborativen Kommunikationskultur“, in: Kleiner, Marcus S./Wilke, Thomas (Hrsg.), Performativität und Medialität Populärer Kulturen. Theorien, Ästhetiken, Praktiken, Wiesbaden 2013, S. 435–452.
Rogoff, Irit: „The expanded field“, in: Martinon, J.-P (Hrsg.): The curatorial: a philosophy of curating, London/New York 2013, S. 41–48
Savoy, Bénédicte: Die Provenienz der Kultur: von der Trauer des Verlusts zum universalen Menschheitserbe, Zweite Auflage, Berlin 2018.
Seel, Martin: „Ereignis. Eine kleine Phänomenologie“, in: Müller-Scholl, Nikolaus (Hrsg.): Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterfahrung. Anspruch und Aporien, Bielefeld 2003, S. 37–47.
Slaby, Jan: „Existenzielle Gefühle und In-der-Welt-sein”, in: Kappelhoff, Hermann/Bakels, Jan-Hendrik/Lehmann, Hauke/Schmitt, Christina (Hrsg.): Emotionen. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart (i. Dr., finaler Entwurf).
Simondon, Gilbert: Die Existenzweise technischer Objekte, Zweite Auflage, Zürich 2012.
Sloterdijk, Peter: Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus, Frankfurt a. M. 1999.
Villeneuve, Pat/Love, Ann Rowson (Hrsg.): Visitor-centered exhibitions and edu-curation in art museums, Lanham 2017.