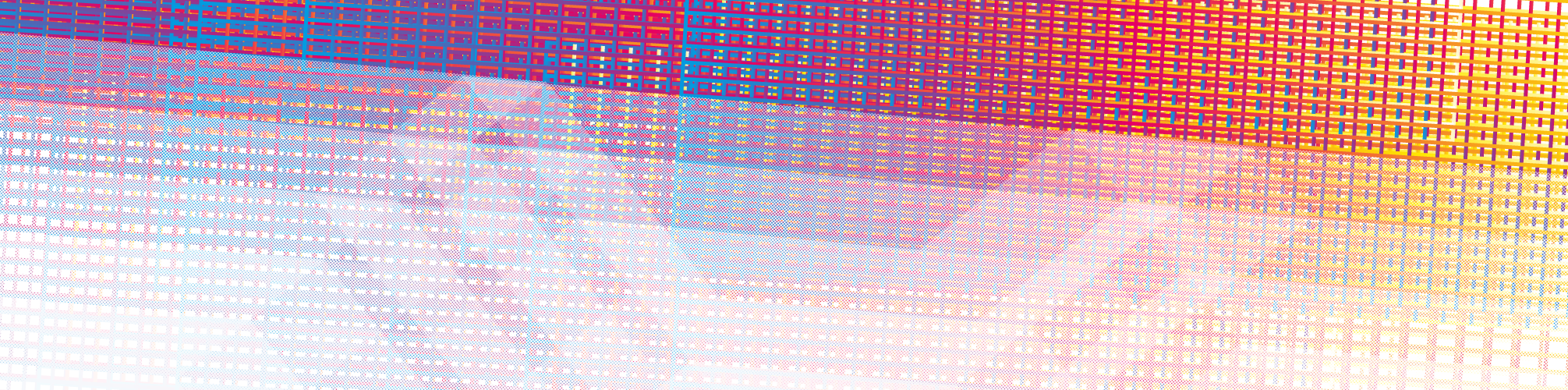Wo stehen wir? Wohin gehen wir?
Neun Thesen zum Forschungsfeld postdigitaler Kunstpraktiken in der kulturellen Bildung.
Paradigmenwechsel. Digitalität ist in einer Weise allgegenwärtig, dass sie eher durch Abwesenheit (z.B. durch Ausfall des Internet) denn durch Anwesenheit wahrnehmbar wird. Die ehedem Neuen Medien haben eine Lebenswirklichkeit bedingt und bereitet, die kaum mehr – man denke an Smartphones – wegzudenken ist und bereits postdigitale Züge angenommen hat. Die Paradigmenwechsel im Laufe der Menschheitsgeschichte beruhen allesamt auf der Einführung neuer Medien und (damit verbunden) neuer Gedächtnisspeicher. Was anfänglich noch an Szene und Körper gebunden war, entfernt sich mit dem Bild, der Schrift, zuletzt der Telematik zunehmend von der Lebenswelt. Mehr Abstraktion als die Zahlen 0/1 gibt es nicht. Die „Kehrtwende“, so Vilém Flusser, ist unumgänglich.
Da die Künste immer schon dazu beigetragen haben, bevorstehende Änderungen anzuzeigen und die Wahrnehmungstradition zu transformieren (etwa mit der Zentralperspektive zu Beginn der Neuzeit), bleibt zu fragen, welchen Wandel etwa die durch digitale Simulation angereicherten immersiven Künste derzeit einleiten. Zweifelsohne handelt es sich um eine Umkehr, ob tatsächlich zurück in die sinnlich erfahrbare Lebenswelt, ist fraglich, denn die Differenz zwischen realer und virtueller Wirklichkeit droht in fiktionalen, emotional angereicherten Räumen zu verschwinden. Während die anfänglich begeistert aufgenommene ‘digitale Revolution’ mehr und mehr in kulturkritischer Absicht befragt wird, hat sich die Computertechnologie längst (und zunehmend unsichtbar) unserer Lebens- und Kommunikationsformen bemächtigt, sie tiefgreifend und nachhaltig geformt und verändert.
Anthropozän. Die Menschheit, so Flusser, erfindet den Hebel, um sich Arbeit zu ersparen. Mit Blick auf autonom funktionierende, inzwischen ‘lernfähige’ (also datenprozessierende) Maschinen hat sie buchstäblich ganze Arbeit geleistet – von der Verschränkung physikalischer, biologischer und virtueller Wirklichkeiten auf der Makro-, Mikro- und Nanoebene ganz zu schweigen. Die Rede ist von einer transhumanen Wende. Die einen erwarten nun endlich die Vollendung einer menschengemachten Welt, die anderen befürchten den Untergang der Conditio Humana. Die umfassenden Eingriffe des Menschen in die innere und äußere Natur lassen gar Rufe nach einem neuen Erdzeitalter aufkommen: Im Anthropozän scheint dann auch das Konzept einer uns gegenüberliegenden Natur und dichotome Kategorien wie Subjekt/Objekt, physisch/digital, real/virtuell überholt. Die Zukunft wird am Bildschirm oder im biochemischen Labor verhandelt und erweist sich angesichts des drohenden ökologischen Kollapses, des entfesselten Finanzkapitalismus, der privatisierten öffentlichen Hand und der massiven sozialen Unruhen zudem als nicht mehr kalkulierbar. Je weniger Kontrolle darüber, desto massiver ihr Einsatz.
Performancegesellschaft. Performance ist nicht nur ein Ausdrucksmittel in den Künsten, sondern eine technische, ökonomische, kulturelle und soziale Größe, die die Produktivität bemisst. Kontrolle hat die Disziplin als Macht-Wissen-Dispositiv abgelöst und befördert einen Verwertungsprozess, der zuletzt auch den Menschen als ‘Humankapital’ wettbewerbstaugliche Leistung abverlangt – ganz freiwillig. Als ‘Kuratoren ihrer selbst’ gebrauchen sie noch dazu Praktiken, die ehedem einer kleinen künstlerischen Avantgarde vorbehalten waren. Ein „Kreativitätsdispositiv“ (Andreas Reckwitz) bestimmt die Arbeits-, Konsum- und Beziehungsformen, fordert dauernde Innovation und wetteifernde Performance im Buhlen um Aufmerksamkeit. Zudem läuft der Ästhetisierungsschub in der Werbung, im Design, in der Pop- und Gamekultur den klassischen Künsten den Rang ab, die sich ihrerseits (besonders Theater) geradezu umgekehrt de-ästhetisieren. Die Wirklichkeit der Kunst erscheint mitunter wirklicher als die Alltagswirklichkeit – mit Blick auf Live Action Role Playing oder Virtuelle Realität allemal.
Ausbruch der Kunst. Schon lange gibt es Versuche, die Trennung zwischen Kunst und Leben zu überwinden – man denke an die „Readymades“ von Marcel Duchamps, an Dada oder die Situationisten, die die Verwirklichung der Kunst gleich ganz im Leben suchten, an die „Soziale Plastik“ von Josef Beuys oder Bertolt Brechts Vorstellung des Theaters als „Kolloquium über gesellschaftliche Zustände“. Am Ende hat die Demokratisierung der Künste dazu geführt, dass sie ihr widerständiges Potential eingebüßt haben. Es geht nicht mehr um Werke, sondern Ereignisse; die Welt wird nicht in Distanz gespiegelt oder kritisiert, die Künste ereignen sich vielmehr inmitten der disparaten, empirischen Wirklichkeiten. Der öffentliche Raum wird zum Kreativlabor, die Imbissbude zur Tanzbühne, der Bunker zum Ausstellungsraum, die Daimler-Aktionärsversammlung zum Aufführungsort, die ausgediente Heilstätte zum Musiksaal, der soziale Brennpunkt zur Bühne für die Dramen des Prekären. Derweil wird im White Cube und in der Black Box umgekehrt – außer Kunst – das Leben in Form geselliger Spiele, Essensperformances, politischer Debatten inszeniert, Mitmachtheater und bisweilen sogar der Aufstand geprobt.
Kunst als Dienstleistung. Die Demarkationslinien zwischen den Kunstgattungen sind aufgelöst, und eine „Relationale Ästhetik“ (Nicolas Bourriaud) stellt die Autonomie der Kunst in Frage. Die Vorstellung einer „Kunst als soziale Praxis“ (Shannon Jackson) geht gar davon aus, dass die Künste niemals autonom, sondern immer schon abhängig waren (das Bild vom Pinsel, vom Bildträger, vom Ausstellungsort, vom Käufer etc.), ihre außerkünstlerische Anwendung eine selbstverständliche Dienstleistung sei. Mit Blick auf die zunehmend individualisierte und ent-solidarisierte Gesellschaft könnten gerade die Künste (und hier besonders die darstellenden) das wechselseitige Aufeinander-angewiesen-sein, also die grundlegende relationale Verfasstheit menschlicher Lebens- und Kommunikationsformen erlebbar machen, inklusiv wirken und so den Gemeinschaftssinn fördern.
Partizipation. Womit sich das allgemeine Bildungsanliegen offenbar schwertut (Persönlichkeit stärken, Kompetenz einüben, Wissensdefizite ausgleichen, Integration leisten, Zugehörigkeit herstellen etc.), soll mit Hilfe der Künste entfaltet werden. Dabei geht es weniger um eine Vermittlung hin zur Kunst als vielmehr darum, Individuen zu ermächtigen, kompetent am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Doch auf der Bühne die Stimme zu erheben, bedeutet noch nicht, auch sonst ein Mitspracherecht zu haben. Partizipative Anliegen wollen auf ‘gleicher Augenhöhe’ agieren, sind aber aufgrund der Angebotsstruktur zuvorderst asymmetrisch, erwarten Teilhabe – wobei Teilhabe oft nur erwünscht ist, wenn sie der Vorstellung der Kunstschaffenden entspricht und Dissens ausschließt. Partizipation im Modus der Kunst wird mit harmonisierendem Gemeinschaftserleben und mit unmittelbarem Austausch verwechselt. Sie trägt zur Kulturalisierung von Problemlagen bei, die anderorts zu lösen wären.
Professionalisierung. Angesichts interaktiver Kommunikationsmedien agieren junge Leute heutzutage als semiprofessionelle Macher, die wissen, dass Kompetenz, Handlungs- und Leistungsfähigkeit gefordert und Performance eine Machtstrategie ist (selbst ‘Bildungsbenachteiligte’, die sich als gesellschaftliche Verlierer wähnen und mit diesem Wissen ein Negativ-Image kultivieren). Sie kennen die Strategien, animieren Bilder zu GIFs, bestehen Abenteuer in Runaways, überwinden Hindernisse im Jump ‘n’ Run, erproben Rollen in World of Warcraft, bauen 3-D-Welten mit Minecraft. Sie beherrschen bisweilen auch die Technologien, überwinden die Dichotomie zwischen Produktion und Rezeption, professionalisieren sich in Indiegame-Programmierung oder vernetzen sich live in der Demo-Szene. Das Wissen wird kaum in formellen oder non-formellen Bildungszusammenhängen, sondern informell, in selbstorganisierter, netzwerkgestützter Autorenschaft, bisweilen komplizenhafter Koproduktion generiert. In der Kulturellen Bildung werden Kunstschaffende daher weniger gebraucht, um Individuen zu befähigen, zu aktivieren oder zum sozialen Austausch (gar im Format der Gamification) anzuregen, sondern um sie kritisch zu begleiten.
Intervention. Kritisch begleiten heißt intervenieren – selbstgefällige Dynamik irritieren, unbewusste Automatismen stören, dem Konsumverhalten und Wohlgefallen am Unbestimmten begegnen, aber auch die vermeintliche Immaterialität des Digitalen, die durch algorithmische Steuerung und Personalisierung erzeugte Aufmerksamkeitsökonomie der Suchmaschinen oder sozialen Medien sichtbar machen. Nicht weil es in der Kunst ein Wissen darüber gäbe, was zu tun sei, sondern um mittels Intervention dem schleichenden Bedeutungs- und Freiheitsverlust auf die Spur kommen, mittels Unterbrechung die Nähe in die Ferne rücken, aus dem Nicht-Wissen, der Fremde und Ungewissheit heraus (Sinn-) Fragen und Suchbewegungen provozieren.
Mit Blick auf Immersion allemal, die durch das Versenken in ein Buch, Bild oder Theaterstück zwar auch erfahren, durch technische Errungenschaften wie VR-Brillen jedoch in einer Weise intensiviert wird, dass die virtuelle Umgebung real erscheint: physisch qua Wahrnehmung, psychisch qua Imagination. Die Trennung zwischen Subjekt und Medium ist aufgehoben, das Medium selbst nicht mehr als solches wahrnehmbar. Das Pokémon-Go-Spiel geht noch einen Schritt weiter: Die Jagd auf kleine Monster findet via Smartphone statt, aber die Suche erfolgt in der realen Welt, deren Abbild überformt wird – nicht immer zugunsten einer geschärften Wahrnehmung für diese. Der per GPS übertragene Standort wird mittels Augmented Reality in einer Weise ‘überschrieben’, dass die Grenze zwischen medialen und empirischen Räumen (wie im Rausch) nicht nur oszilliert, sondern im Virtuellen tendenziell verschmilzt.
Nichttun. Intervenieren heißt zuletzt auch, der im digitalen Raum vorherrschenden Verfügungsgewalt entgegenzutreten. Repräsentationskritische Auseinandersetzungen mit Bild, Text oder Sprache haben im Zuge des sogenannten Performative Turn das Hervorbringen und Herstellen betont und so dem Machbarkeitswahn einer neoliberalen Moderne womöglich sogar Vorschub geleistet. Vergessen wurde, dass Kunst (und besonders immersives Erleben) immer auch Widerfahrnis, Anmutung, ja, auch Zumutung ist. Es wurde übersehen, dass im Blick-Akt die Künste zurückblicken und dabei die Sinne und Vorstellungskräfte berührt werden. Seit einiger Zeit wird der Wert der Emotionen in der Kunsterfahrung, das „Pathos“ (Kathrin Busch) und die Kraft der Passivität wiederentdeckt, um darin Raum (und Zeit) für Resonanz auszuloten – Momente, in denen Eindrücke innerlich schwingen, Gefühle verarbeitet und als Emotionen bewusst wahrgenommen und reflektiert werden können.
Wir mögen „Jenseits des autonomen Subjekts“ (Hannah Meißner) sein, aber nicht jenseits der Kritik – Menschen, die angesichts des postdigitalen Zeitalters zwar kaum noch aus der Distanz heraus, aber womöglich gerade durch ihre Einlassung kritisches Potential entwickeln und dabei die Ausprägungen desselben Gegenstands in eine andere Richtung treiben. Praktiken, die Formen des Widerstands erproben, auch solche, die das „Mögliche erschöpfen“ (Gilles Deleuze) und sich versuchsweise dem Nichttun stellen, das unproduktiv, aber gleichwohl der Anstrengung bedarf – ein (Los-)Lassen, das im besten Fall andere Sinnhorizonte finden und öffnen kann.
Gesucht: „Die Lücke im Ablauf“ (Heiner Müller) – just an der Schnittstelle physischer und digitaler Wirklichkeiten.